Akkuspender
 Ich
habe lange gehadert und gerechnet, ob es wirklich Sinn macht, die am häufigsten
benötigten Batterietypen durch Akkus zu ersetzen. Bei den Preisen für gute
Akkus und ein entsprechendes Ladegerät dauert es nämlich eine ganze Weile,
bis sich die Kosten amortisieren und man tatsächlich etwas dabei spart.
Überzeugt haben mich am Ende zwei Punkte: Erstmal sind nun Elektrogeräte
hinzugekommen, die mit einer Ladung gleich eine zweistellige Anzahl von
Batterien benötigen und zweitens ist die sympathischste Eigenschaft einer
neuen Batterie, dass sie bei Bedarf da ist und nicht erst beschafft werden
muss. Vor allem Letzteres war ein ständiges Ärgernis, sodass ich dann doch
entsprechend investiert habe.
Ich
habe lange gehadert und gerechnet, ob es wirklich Sinn macht, die am häufigsten
benötigten Batterietypen durch Akkus zu ersetzen. Bei den Preisen für gute
Akkus und ein entsprechendes Ladegerät dauert es nämlich eine ganze Weile,
bis sich die Kosten amortisieren und man tatsächlich etwas dabei spart.
Überzeugt haben mich am Ende zwei Punkte: Erstmal sind nun Elektrogeräte
hinzugekommen, die mit einer Ladung gleich eine zweistellige Anzahl von
Batterien benötigen und zweitens ist die sympathischste Eigenschaft einer
neuen Batterie, dass sie bei Bedarf da ist und nicht erst beschafft werden
muss. Vor allem Letzteres war ein ständiges Ärgernis, sodass ich dann doch
entsprechend investiert habe.
 Und
um eine Investition geht es hier allemal. Zwischen 20 und 40 Stück der gängigsten
Typen AA (Mignon), AAA (Micro) und 9V (E-Block) samt Ladegerät, das möglichst
viele auf einmal lädt, machen einen nicht unerheblichen Betrag aus. Bis
der durch eingesparte Batterien wieder drin ist, wird ein Weilchen vergehen.
Entschieden habe ich mich nach entsprechendem Austausch mit anderen Anwendern
für eneloop-Akkus, die mit minimalem Ladungsverlust bei Lagerung werben.
Als 9V-Blocks gab's die nicht, da waren Ni-MH Typen von Camelion das Modell
der Wahl.
Und
um eine Investition geht es hier allemal. Zwischen 20 und 40 Stück der gängigsten
Typen AA (Mignon), AAA (Micro) und 9V (E-Block) samt Ladegerät, das möglichst
viele auf einmal lädt, machen einen nicht unerheblichen Betrag aus. Bis
der durch eingesparte Batterien wieder drin ist, wird ein Weilchen vergehen.
Entschieden habe ich mich nach entsprechendem Austausch mit anderen Anwendern
für eneloop-Akkus, die mit minimalem Ladungsverlust bei Lagerung werben.
Als 9V-Blocks gab's die nicht, da waren Ni-MH Typen von Camelion das Modell
der Wahl.
Nun werben die Hersteller von Akkus neben der Ladung und der Bauart vor allem auch mit der Mindestanzahl von Ladevorgängen, die so ein Stück mitmachen will. Von mindestens 1.000 Ladevorgängen ist da die Rede. Das klingt prima, wirft aber ein Problem auf.
Hat man nämlich in Summe an die 100 Akkus herumfliegen und alle hübsch
geladen, dann findet sich schnell eine Kiste, auf die man "volle Akkus"
schreibt und der die Dinger gelagert werden. Wird ein Akku leer, fliegt
er in die Nachbarkiste "leere Akkus" und wenn sich dort einige angesammelt
haben, liegt eine neue Laderunde an. Die frisch geladenen Akkus landen wieder
in Kiste 1 und zwar obenauf. Beim nächsten Bedarf werden sie wieder entnommen
und so weiter und so fort. Will sagen:
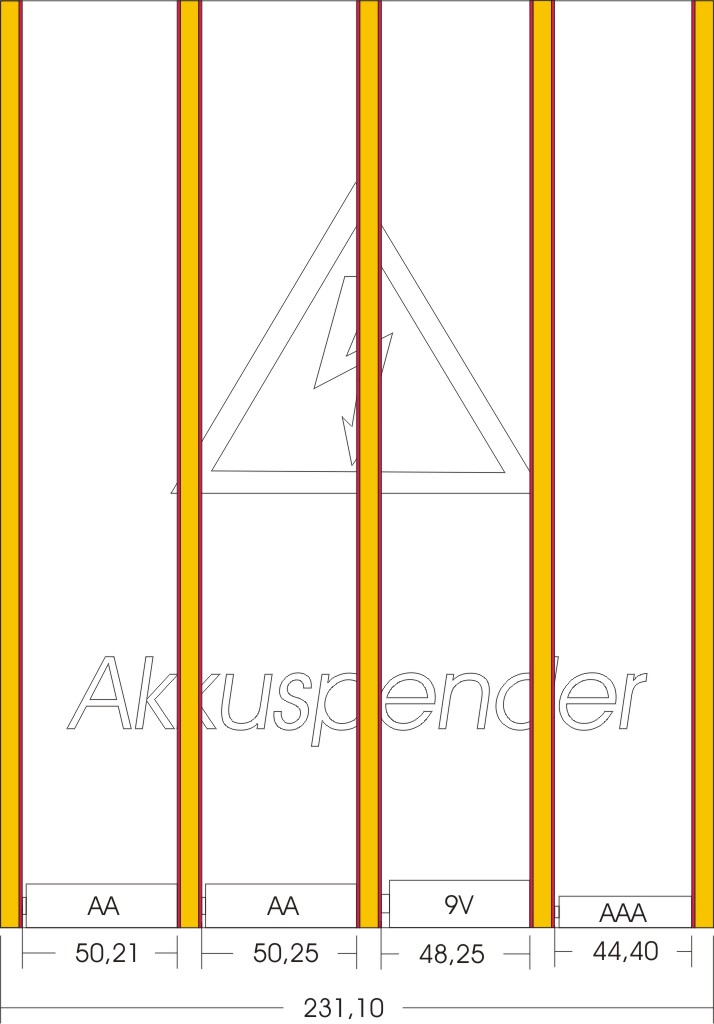 Die obersten
Akkus in der Kiste "volle Akkus" werden ständig benutzt, die unteren nie.
Schließlich hat man ja nicht genau so viele Akkus, wie man benötigt, sondern
eher in Richtung doppelt so viele - man will ja im Bedarfsfall gleich einen
frischen Austauschakku zur Hand haben. Wie kann man aber nun erreichen,
dass nicht nur immer die obersten, sondern alle Akkus in etwa gleich oft
benutzt werden?
Die obersten
Akkus in der Kiste "volle Akkus" werden ständig benutzt, die unteren nie.
Schließlich hat man ja nicht genau so viele Akkus, wie man benötigt, sondern
eher in Richtung doppelt so viele - man will ja im Bedarfsfall gleich einen
frischen Austauschakku zur Hand haben. Wie kann man aber nun erreichen,
dass nicht nur immer die obersten, sondern alle Akkus in etwa gleich oft
benutzt werden?
Die Lösung ist der Akkuspender, eine kleine Kiste mit Lagerschächten für jede Akkuform. Volle Akkus kommen oben hinein und werden unten entnommen. Leere werden geladen und kommen wieder oben hinein. Das ganze hübsch an der Wand über dem Ladegerät platziert und für die verschiedenen Batterietypen passend geformt - das sollte es sein.
Die Zeichnung rechts ist eine Draufsicht, wobei aber die Deckplatte mit der Aufschrift noch in den Hintergrund gestellt ist, denn sie ist noch nicht an der Reihe. Fünf Leisten sind auf einer Rückwand angebracht und zwar im Abstand der Breite der Akkus plus einem Millimeter Spiel an den Seiten. Ihre Abstände ergeben die Gesamtbreite der Box, die nachher oben offen ist und unten (so der naive Erstgedanke) die Entnahme erlaubt. Aufgrund der Anzahl der vorhandenen Akkus gibt es für den AA-Typ zwei Fächer. Wie man an der vom Zeichenprogramm generierten Bemaßung sieht, ist das auf der zweiten Nachkommastelle etwas ungenau, aber das spielt bei diesen Dimensionen in Holz keine Rolle.
Und los ging's, die Werkstatt gab alles dafür benötigte Material her.
Die Rückwand besteht aus einem 2mm-Flugzeugsperrholzrest aus dem Projekt
"Omas Küchenbuffet". Darauf sind die 5 Leisten
geklebt, die aus 6mm Kiefernsperrholz bestehen. Die hiervon verbliebenen
Reste aus dem Sekretär-Projekt hatten wir ja bereits
zu Ritterkram verarbeitet, aber selbst was dabei
übrig blieb, reichte für diese Anwendung noch aus.

Auf die Grundplatte werden zunächst die äußeren Leisten geleimt. Man sieht auf dem Bild die drei übrigen Leisten links bereit liegen. Ferner sieht man eine Zwinge, die die beiden Leisten nach innen drückt sowie einen Keil in der Mitte, der sie wiederum außen hält. Somit können die frisch verleimten Leisten in beide Richtungen nicht auswandern, was sie ohne entsprechende Stütze gern versuchen würden. Ist das trocken, geht es gleich mit den mittleren Leisten weiter. Ein Akku oben und unten plus einem Stückchen von dem 2mm-Material bestimmt den Abstand zur nächsten Leiste. In der Mitte packen die Zwingen nur ganz oben und unten, weshalb der Anpressdruck mit Gewicht von oben vergrößert wird.
Da diesem Projekt kaum Planung voranging, musste es zwangsläufig zu Schwierigkeiten kommen. Obwohl ich nämlich die Leisten unten schon abgeschrägt hatte, damit man die Akkus an der Unterseite entnehmen kann, erwies sich das dennoch als unmöglich, denn man kann sie dort mit den Fingern nicht greifen. Grmpf.
Nach einigem Überlegen verblieb als einzig praktikable Lösung, die Akkus
unten in eine
 Art Schublade
fallen zu lassen, die man dann herauszieht und dort bequem den Akku entnehmen
kann. Diese Lösung bietet aber auch gleich wieder ein paar neue Probleme
an. Zieht man die Schublade heraus, fallen die nachrückenden Akkus in den
freigewordenen Schacht und die Schublade geht nicht wieder rein. Sie muss
also eine Form haben, die auf der Oberseite eine Lücke hat, die der Akku
genau ausfüllt. Zusätzlich muss jeder Akku genau in diese Lücke geführt
werden, denn die Dinger haben ja unterschiedliche Maße.
Art Schublade
fallen zu lassen, die man dann herauszieht und dort bequem den Akku entnehmen
kann. Diese Lösung bietet aber auch gleich wieder ein paar neue Probleme
an. Zieht man die Schublade heraus, fallen die nachrückenden Akkus in den
freigewordenen Schacht und die Schublade geht nicht wieder rein. Sie muss
also eine Form haben, die auf der Oberseite eine Lücke hat, die der Akku
genau ausfüllt. Zusätzlich muss jeder Akku genau in diese Lücke geführt
werden, denn die Dinger haben ja unterschiedliche Maße.
Zu dem Zweck wurde der bisherige Stand einfach umgedreht, unten war nun
oben und links wurde rechts. Auf die Rückseite kamen fünf weitere Leisten,
die nach unten ein Stück überstehen und dann mit einer
 Bodenleiste
verbunden wurden. Dadurch entstanden vier Fächer, in denen die Schubladen
laufen sollen. Die Form der Schubladen fällt so aus, dass sie das Fach in
der Höhe komplett ausfüllen und außerdem so weit ausgefalzt sind, dass ein
Akku genau in die Lücke passt. Der unterste Akku fällt also bei eingelassener
Schublade in diese Lücke. Damit er das auch tut, werden in das untere Ende
der Fächer Keile eingeleimt, die den Akku genau in die Auslassung der Schublade
führen. Im zweiten Fach von links ist das nicht notwendig, denn die dort
gelagerten 9V-Blöcke füllen das Fach komplett aus - als größte Akkuform
waren sie Maßgeber für die Dimensionen der Lagerschächte. Zieht man die
Schublade nun heraus, können weitere Akkus nicht herunterfallen, weil die
Schublade weiter hinten der Höhe des Faches entspricht und es somit nach
unten abschließt. Damit im Falle des kompletten Herausziehens der Schublade
keine Akkus herausregnen, muss der Auszug begrenzt werden, es gibt also
hinten einen Anschlag (kleines Detailbild). Vorn wird eine Blende
ergänzt, die an der Unterkante anschlägt. Eine kleine Holzkugel dient als
Knauf, davon habe ich noch ein ganzes Glas voll aus dem
Adventskalender-Projekt. Die Bodenleiste wurde
später noch auf der Rückseite mit einer waagerechten Stützleiste ergänzt,
die sie mit den 5 senkrechten Leisten verleimt. Das entlastet die schmalen
Leimstellen an der Verbindung der Bodenleiste mit den senkrechten Leisten,
schließlich liegt hier das vereinte Gewicht aller Akkus auf.
Bodenleiste
verbunden wurden. Dadurch entstanden vier Fächer, in denen die Schubladen
laufen sollen. Die Form der Schubladen fällt so aus, dass sie das Fach in
der Höhe komplett ausfüllen und außerdem so weit ausgefalzt sind, dass ein
Akku genau in die Lücke passt. Der unterste Akku fällt also bei eingelassener
Schublade in diese Lücke. Damit er das auch tut, werden in das untere Ende
der Fächer Keile eingeleimt, die den Akku genau in die Auslassung der Schublade
führen. Im zweiten Fach von links ist das nicht notwendig, denn die dort
gelagerten 9V-Blöcke füllen das Fach komplett aus - als größte Akkuform
waren sie Maßgeber für die Dimensionen der Lagerschächte. Zieht man die
Schublade nun heraus, können weitere Akkus nicht herunterfallen, weil die
Schublade weiter hinten der Höhe des Faches entspricht und es somit nach
unten abschließt. Damit im Falle des kompletten Herausziehens der Schublade
keine Akkus herausregnen, muss der Auszug begrenzt werden, es gibt also
hinten einen Anschlag (kleines Detailbild). Vorn wird eine Blende
ergänzt, die an der Unterkante anschlägt. Eine kleine Holzkugel dient als
Knauf, davon habe ich noch ein ganzes Glas voll aus dem
Adventskalender-Projekt. Die Bodenleiste wurde
später noch auf der Rückseite mit einer waagerechten Stützleiste ergänzt,
die sie mit den 5 senkrechten Leisten verleimt. Das entlastet die schmalen
Leimstellen an der Verbindung der Bodenleiste mit den senkrechten Leisten,
schließlich liegt hier das vereinte Gewicht aller Akkus auf.
 Zuletzt
ist die Frontplatte dran, die schon in der Zeichnung weiter oben angedeutet
wurde. Neben der Aufschrift und der Beschriftung der Schubladen wird sie
vom Warnzeichen "Warnung vor gefährlicher elektrischer Spannung" geziert.
Das ist in diesem Zusammenhang natürlich Unsinn, sieht aber nett aus
Zuletzt
ist die Frontplatte dran, die schon in der Zeichnung weiter oben angedeutet
wurde. Neben der Aufschrift und der Beschriftung der Schubladen wird sie
vom Warnzeichen "Warnung vor gefährlicher elektrischer Spannung" geziert.
Das ist in diesem Zusammenhang natürlich Unsinn, sieht aber nett aus
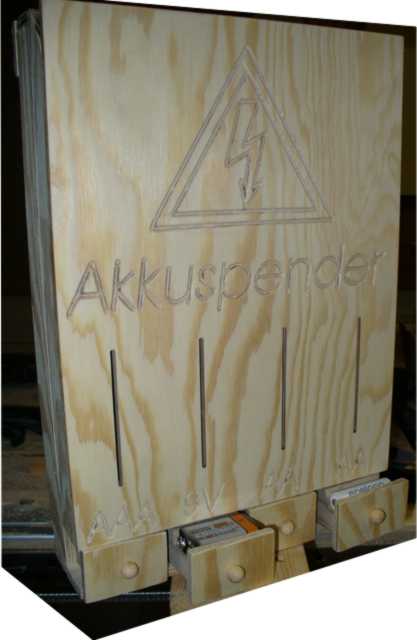 und mir
war kein passendes Symbol für Akkus bekannt. Die Frontplatte entstand aus
einem fehlerhaft gefrästen Element des Sekretärs,
das nicht zu gebrauchen, zum Wegwerfen aber zu groß und zu schade war. Irgendwann
würde eine Anwendung dafür kommen und nun war es soweit. Die Schriften wurden
mit einem 60° V-Fräser eingebracht, die senkrechten Schlitze (kamen nachträglich
dazu) und das Ausfräsen erfolgte mit einem 3mm Nutfräser. Die Schlitze dienen
der Übersicht über den Füllstand und erlauben eine Justierung der Akkus,
wenn sie beim Einwerfen von oben mal verkanten.
und mir
war kein passendes Symbol für Akkus bekannt. Die Frontplatte entstand aus
einem fehlerhaft gefrästen Element des Sekretärs,
das nicht zu gebrauchen, zum Wegwerfen aber zu groß und zu schade war. Irgendwann
würde eine Anwendung dafür kommen und nun war es soweit. Die Schriften wurden
mit einem 60° V-Fräser eingebracht, die senkrechten Schlitze (kamen nachträglich
dazu) und das Ausfräsen erfolgte mit einem 3mm Nutfräser. Die Schlitze dienen
der Übersicht über den Füllstand und erlauben eine Justierung der Akkus,
wenn sie beim Einwerfen von oben mal verkanten.
Im Ergebnis ist ein praktisches Kästchen entstanden, das seinen Zweck prima erfüllt. Allerdings ist es im Detail krumm und schief, denn ich habe außer der Breite der Fächer nichts gemessen, sondern nur alles nach Auge und Anhalten ausgesägt, beigeschliffen und angeklebt. Das ging dafür aber sehr schnell und einfach und ist problemlos nachzubauen.
Ich habe übrigens in diesem Zusammenhang angefangen, mir Einlinienschriften anzufertigen. Mehr dazu im nächsten Projekt.
Einige Jahre später ist hier vielleicht eine kleine Ergänzung angesagt:
Der Akkuspender hat nun ein gesundes Maß Praxiserfahrung gesammelt und alle
Akkus in den Fächern haben das Ding einige Male durchwandert. Das gilt ganz
besonders für die 9V-Blöcke, die in Rauchmeldern zwar nur die halbe Einsatzdauer
von Batterien haben, dafür aber eben sofort für den Austausch verfügbar
sind. Entgegen der ursprünglichen Planung hat es sich durchgesetzt, eine
Zwischenstation im Ladegerät vorzusehen. Wird ein Akku leer, steht dort
ein voller bereit. Der leere kommt in den Akkuspender, von dort wird unten
ein anderer entnommen und ins Ladegerät gesteckt. Das wiederum lädt nur
so lange, wie eben Bedarf daran besteht, der volle Akku wartet also im
 Ladegerät
auf seinen Einsatz und wird von dort entnommen. Die Technik des Akkuspenders
funktioniert bei den 9V-Akkus ausgezeichnet. Bei den zylinderförmigen Akkus
kommt es vor, dass die sich im Schacht verkeilen und daher nicht sauber
in die Schublade nachrutschen - hier könnte die Führung noch optimiert werden.
Was die Anzahl der Akkus angeht, habe ich sogar noch nachgekauft - der Bedarf
wächst ständig, vor allem durch die zunehmende Anzahl von Spielzeugen mit
Batteriebetrieb.
Ladegerät
auf seinen Einsatz und wird von dort entnommen. Die Technik des Akkuspenders
funktioniert bei den 9V-Akkus ausgezeichnet. Bei den zylinderförmigen Akkus
kommt es vor, dass die sich im Schacht verkeilen und daher nicht sauber
in die Schublade nachrutschen - hier könnte die Führung noch optimiert werden.
Was die Anzahl der Akkus angeht, habe ich sogar noch nachgekauft - der Bedarf
wächst ständig, vor allem durch die zunehmende Anzahl von Spielzeugen mit
Batteriebetrieb.
Dabei kommt es seltener auch mal zu Bedarf an Akkus der Größen C (Baby) und D (Mono). Dazu gibt es von der Marke eneloop inzwischen auch passende Akkus, noch praktischer finde ich aber die hier abgebildeten Adapter. Dabei handelt es sich um eine leere Hülle im C- oder D-Format, in die einfach ein AA-Akku gesteckt wird. Der hat dann zwar im Vergleich zum Baby-Akku nur zwei Drittel und im Vergleich zum Mono-Akku nur ein Drittel der Kapazität, dafür aber muss man diese Akkus nicht noch zusätzlich vorhalten und kann stattdessen die bereits vorhandenen verwenden. Damit habe ich mich dann auch gleich mal ausgerüstet und es zeigt sich, dass diese Variante in entsprechenden Spielzeugen allemal ausreicht.
Was die Amortisation angeht, bin ich inzwischen auch zuversichtlicher. Die Einsatzdauer im Betrieb liegt bei etwa der Hälfte der einer Batterie und die Kosten sind etwa 4mal höher als die einer Markenbatterie. Das heißt, nach 8 Zyklen hat der Akku sich in etwa amortisiert, wenn man mal vom Stromverbrauch des Wiederaufladens absieht. Okay, sagen wir also nach 10 Zyklen. Viele Geräte wie Rauchmelder (allein davon haben wir ein Dutzend am Start), Fernbedienungen für die Wii, Funkmäuse oder Uhren haben diese Anzahl Zyklen längst durchlaufen. Andere wie Fernbedienungen für TV/HiFi oder Spielzeuge sind genügsamer, melden sich aber auch ab und an. Unterm Strich würde ich sagen, dass wir nach gut 5 Jahren die Investition wieder eingefahren haben werden. Dann aber sind von den 1.000 angegebenen Ladezyklen pro Akku noch keine 10% erreicht und in puncto Flexibilität und Komfort ist diese Lösung ohnehin ungleich besser.