Kleinteilekarussell
 In
jeder Werkstatt fallen Kleinteile an wie Schrauben, Nägel, Dübel in ungezählten
Formen und Größen sowie eine Vielzahl anderer Dinge, die irgendwie gelagert
werden wollen.
In
jeder Werkstatt fallen Kleinteile an wie Schrauben, Nägel, Dübel in ungezählten
Formen und Größen sowie eine Vielzahl anderer Dinge, die irgendwie gelagert
werden wollen.
Dazu gibt es eine ebenso simple wie effektive Methode: man nehme ein
leeres Glas mit Schraubverschluss, schraube den Deckel unter ein Brett und
das Brett an die Wand. Schon kann man das Glas beliebig oft an den Deckel
drehen. Die Unterseite bestehender Wandborde eignet sich natürlich ebenso
gut. Diese Methode bringt gleich vier Vorteile auf einmal: die Teile sind
sichtbar, weil hinter Glas; sie sind geordnet, weil in vielen Behältnissen
untergebracht, sie nehmen keinen anderweitig nutzbaren Stauraum ein und
sie sind jederzeit im schnellen und direkten Zugriff. Diese Lösung gibt es, seit es Gläser
mit Schraubdeckel gibt, ich habe sie einem Heimwerkerbuch aus den 1950er
Jahren entnommen.
Nun erreicht auch die schönste und Platz sparendste Lösung irgendwann ihre Grenzen. Die Werkstattwände sind nicht beliebig lang und man kann die Gläser auch nicht beliebig oft übereinander schichten - die Wände werden für andere Lagerzwecke gebraucht. Nachdem nun an die 100 Gläser verbaut sind, muss die Lösung aktualisiert werden. Neue Gläser stehen bereit, aber sie können nirgendwo mehr hin.
Die Lösung ist das Kleinteilekarussell. Ein Vierkantholz reicht vom Boden
bis zur Decke und wird oben und unten von einem Kugellager gehalten, sodass
es sich leicht um die eigene Achse dreht. Daran werden mehrere runde
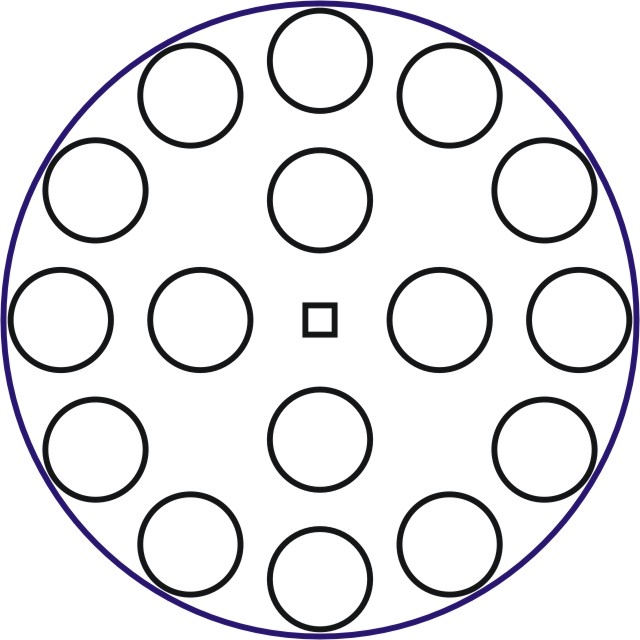 Platten
befestigt, unter denen wie hier links gezeigt die Gläser bzw. deren Deckel
angeordnet sind. Jede Platte fasst 16 Gläser. Davon befinden sich 12 außen
und damit im direkten Zugriff und weitere 4 innen für selten benötigte Dinge
oder zusätzliche Mengen davon, denn nicht jede Packung passt komplett in
ein Glas.
Platten
befestigt, unter denen wie hier links gezeigt die Gläser bzw. deren Deckel
angeordnet sind. Jede Platte fasst 16 Gläser. Davon befinden sich 12 außen
und damit im direkten Zugriff und weitere 4 innen für selten benötigte Dinge
oder zusätzliche Mengen davon, denn nicht jede Packung passt komplett in
ein Glas.
Soweit die Theorie - nun erstmal ab in den Baumarkt. Benötigt wurde Material
für 5 Teller mit je 600mm Durchmesser. Solche Stücke liegen dort praktischerweise
als Verschnitt herum,
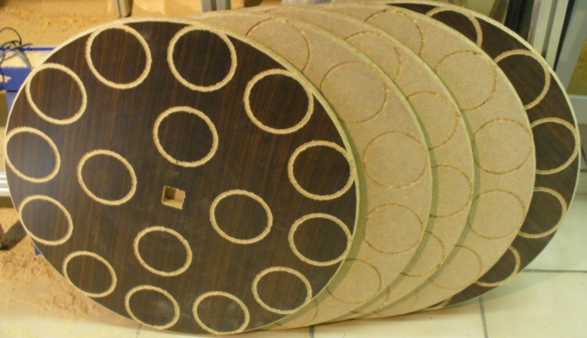 brauchen
keinen Zuschnitt und kosten daher kaum Geld. Eine Stärke von mindestens
19mm sollten sie aber haben, da die ganz außen hängenden Gläser schon ein
wenig Gewicht haben, denn sie sind meist voll mit kleinen Metallteilen.
Die Farbe ist egal - es gab braun furnierte Reste und solche ohne Furnier.
brauchen
keinen Zuschnitt und kosten daher kaum Geld. Eine Stärke von mindestens
19mm sollten sie aber haben, da die ganz außen hängenden Gläser schon ein
wenig Gewicht haben, denn sie sind meist voll mit kleinen Metallteilen.
Die Farbe ist egal - es gab braun furnierte Reste und solche ohne Furnier.
Die oben gezeigte Zeichnung wurde also fünfmal gefräst. Die schwarzen Linien nur in 2mm Tiefe, damit Glasdeckel später ohne Suchen oder Messen an die richtigen Positionen geschraubt werden können. Der Rest wird durchgefräst, in 10 Schritten á 2mm. Dann die Ränder glätten und mit dem Viertelstabfräser etwas abrunden - fertig.
Nun werden die Deckel der gesammelten und zunächst natürlich gespülten
Gläser aufgeschraubt. Es müssen keine gleichartigen Gläser sein,
 aber hübscher
ist es doch. In den eingefrästen Kreisen lässt sich der Deckel nun problemlos
mittig ausrichten, auf den Millimeter kommt es dabei nicht an. Wichtig ist
aber, dass der Abstand zwischen zwei Gläsern mindestens so groß ist, dass
man noch bequem mit den Fingern dazwischen kommt, um ein Glas greifen und
abschrauben zu können.
aber hübscher
ist es doch. In den eingefrästen Kreisen lässt sich der Deckel nun problemlos
mittig ausrichten, auf den Millimeter kommt es dabei nicht an. Wichtig ist
aber, dass der Abstand zwischen zwei Gläsern mindestens so groß ist, dass
man noch bequem mit den Fingern dazwischen kommt, um ein Glas greifen und
abschrauben zu können.
 Hat das
Glas an irgendeiner Stelle mehr Durchmesser als am Deckel, so ist auch das
zu berücksichtigen - bei meinen Gläsern ist das zum Beispiel der Fall.
Hat das
Glas an irgendeiner Stelle mehr Durchmesser als am Deckel, so ist auch das
zu berücksichtigen - bei meinen Gläsern ist das zum Beispiel der Fall.
Der Deckel wird also mittig ausgerichtet und erhält mittels Dorn und Holzhammer drei Löcher. Das vereinfacht das Anschrauben gleich dreifach, denn es stanzt den Deckel durch, heftet ihn an die Platte und schafft eine Mulde, in der die Schraube sofort packt. Kleine Schräubchen besorgen den Rest, drei pro Deckel sind optimal. Diese Übung muss vor dem späteren Zusammenbau erfolgen, wenn man sie später nicht ungleich mühsamer unter der montierten Platte vornehmen will. Mit eingeschraubten Gläsern sieht's dann wie hier rechts aus. Erinnert irgendwie an eine Deckenleuchte - mal festhalten die Idee, vielleicht geht in die Richtung auch noch was...
Deckel waren erstmal für 4 Teller da - das Stanzen und Anschrauben von
16 *4 *3 = 192 Löchern bringt nicht den ganz großen Spaß, ist aber irgendwann
erledigt. Dann werden die fertigen Teller auf das Kantholz gesteckt, dessen
Seitenstärke natürlich zuvor definiert wurde und maßgebend für das
 quadratische
Loch in der Mitte der Deckel ist. Ein Kantholz ist besser geeignet als eine
Stange, weil die Teller sich hier im quadratischen Ausschnitt nicht verdrehen
können und die Gläser jedes Tellers bei gleich
quadratische
Loch in der Mitte der Deckel ist. Ein Kantholz ist besser geeignet als eine
Stange, weil die Teller sich hier im quadratischen Ausschnitt nicht verdrehen
können und die Gläser jedes Tellers bei gleich
 gefrästen
Tellern automatisch genau in der Flucht liegen. Außerdem ergeben sich Flächen
für den nächsten Schritt.
gefrästen
Tellern automatisch genau in der Flucht liegen. Außerdem ergeben sich Flächen
für den nächsten Schritt.
Das Projekt Rankgitter ließ Verschnitt aus Tischlerplatten
zurück, der hier gut zu gebrauchen war. Zunächst werden Reststücke an der
Tischsäge auf gleiche Breite, dann an der Kappsäge auf gleiche Länge gebracht.
Am Schleifteller erhalten die nun entstandenen Klötzchen gefaste Kanten
und schließlich bringt ihnen die Standbohrmaschine zwei Löcher bei, damit
sie beim Anschrauben nicht platzen. Diese Klötzchen werden nun unter und
über den Platten an das Kantholz geleimt und verschraubt. Und zwar 4 unter
den Teller, die ihn tragen und 2 darüber, die verhindern, dass er kippelt.
Mit  diesem
Schritt wird die Höhe der Teller im Raum und auch ihr Abstand zueinander
definiert, er will also geplant sein. Im Bild links sieht die Anordnung
aufgrund des Fluchtpunktes schief aus, natürlich sitzen die Teller
diesem
Schritt wird die Höhe der Teller im Raum und auch ihr Abstand zueinander
definiert, er will also geplant sein. Im Bild links sieht die Anordnung
aufgrund des Fluchtpunktes schief aus, natürlich sitzen die Teller
 aber parallel
- in etwa jedenfalls.
aber parallel
- in etwa jedenfalls.
Jetzt wird die Restekiste umgestülpt und ein wenig improvisiert. Die
Plastikfüße eines alten Küchenelementes lassen sich in der Höhe verstellen
und die Magnetkerne ausgedienter Schrittmotoren haben ein feine kugelgelagerte
Welle. Beides kombiniert mit zwei Klötzen (noch übrig
 von der
Fertigung der Schubladen
des Sekretärs)
ergibt ein oberes und unteres Lager für den Balken mit den Tellern. In die
Klötze werden Aufnahmen gebohrt und die Teile einfach hinein gesteckt -
die Küchenfüße werden vorher an der Bandsäge von dem rechteckigen Klotz
an der Oberseite befreit.
von der
Fertigung der Schubladen
des Sekretärs)
ergibt ein oberes und unteres Lager für den Balken mit den Tellern. In die
Klötze werden Aufnahmen gebohrt und die Teile einfach hinein gesteckt -
die Küchenfüße werden vorher an der Bandsäge von dem rechteckigen Klotz
an der Oberseite befreit.
Dann wird das leere Gerüst aufgestellt und mit den verstellbaren Elementen
oben festgeklemmt. Unten ginge ebenso gut, so ist aber die Standfläche größer.
Zuletzt kommen die Gläser hinein und fertig ist das
 Platz
sparende Kleinteilekarussell. Es dreht wunderbar in den Lagern der Schrittmotoren
und man kommt an jedes Glas mit einem Griff heran.
Platz
sparende Kleinteilekarussell. Es dreht wunderbar in den Lagern der Schrittmotoren
und man kommt an jedes Glas mit einem Griff heran.
Zunächst waren 64 Gläser an 4 Tellern angebracht. Es war aber noch ein fünfter Teller da und es ist Platz für 3 weitere vorhanden. Vorher waren in der Ecke gut 50 kleine Gläser an der Wand verschraubt - nun passen im möglichen Endausbau gut 130 große an die gleiche Stelle.
Das Projekt hat einen Tag gedauert und gut 20 Euro an Material gekostet.
Nach dem Umzug in das eigene Haus wurde die inzwischen erprobte Anbringung weiter optimiert. Die verstellbaren Füße der Küchenelemente waren zwar eine schnelle Lösung zur Fixierung im Raum, neigen aber auf Dauer dazu, sich wieder zu lösen, wenn ständig an dem Ding herumgedreht wird. Besser ist es daher, Ober- und Unterseite dauerhaft zu fixieren, denn sollte das Karussell mal umkippen, gibt es einiges einzusammeln. Im Bild rechts nun der aktuelle Standort in der neuen Werkstatt mit an Decke und Boden verdübelten Klötzen. Nachdem neue Gläser gesammelt waren, konnte der fünfte Teller montiert werden, darunter bleibt immer noch ausreichend Platz für anderen Kram. Die Gläser sind schon wieder alle voll, denn ein neues Haus bringt auch Bedarf an neuen Kleinteilen mit sich, die man vorher nicht brauchte. Mit nunmehr 80 Gläsern wird das zukünftige Streben aber eher in eine sinnvollere Lagerung selten benötigter Teile als in den weiteren Ausbau des Karussells gehen. Trotzdem ist das nach wie vor die Platz sparendste Art, viel Kleinkram übersichtlich auf wenig Fläche zu verstauen. Übrigens sind dies sämtlich Mayonnaisegläser und nach Jahrzehnten kam der Hersteller im Frühjahr 2009 auf die glorreiche Idee, deren Form zu ändern. Das macht der Sache ohnehin ein Ende, denn unterschiedliche Formen würden mir nicht gefallen. Ich habe mich natürlich beschwert und die alte Form zurück gefordert, aber man hat trotzdem an der neuen festgehalten. Für einen weiteren Teller wären aber noch Reserven da, mal sehen.